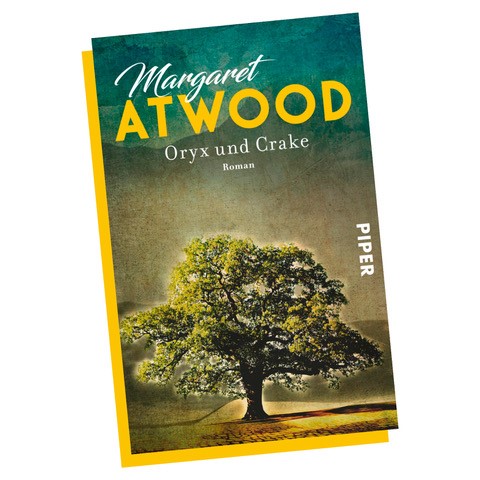
Oryx und Crake Cover_bearbeitet
Margret Atwoods "Oryx und Crake" als Kommentar auf eine Welt, die humanistische Werte gegen ökonomischen Wachstum ausspielt | Bildquelle: Piper
Schule als Konzernschmiede
Ein Beitrag von Lars Schmeink
Ein Szenario, das die Science-Fiction gerne zur Warnung bereithält, ist eine Abhängigkeit aller öffentlicher Lebensbereiche von finanzstarken Konzernen. Da ist auch der Bildungssektor keine Ausnahme – gerade in Anbetracht klammer Staatskassen, maroder Institutionen und der seitens der Industrie häufig vorgebrachten Forderung, Schule und Universität sollten sich am Bedarf des Arbeitsmarktes orientieren. Schon jetzt haben Betriebe erkannt, dass die Ausbildung des eigenen Konzern-Nachwuchses durchaus einen Sinn ergeben kann: ob Edeka-Akademie (unironisch „Ekademie“ genannt) oder Gruner + Jahrs Henri-Nannen-Schule. Und auch die Idee, dass große Arbeitgeber für ihre Belegschaft ein Lebensumfeld inklusive Wohnort schaffen – und damit auch Schule, Marktplatz und Sozialstrukturen – ist nicht neu. Das belegen die Arbeiterstädte des 19. Jahrhunderts: von Saltaire in Nordengland bis Hershey, PA. Da ist die konzerneigene Schule nur konsequent…
In der aktuellen SF beschreibt Margaret Atwood ein solches Szenario in ihrem Roman Oryx und Crake (2005, Btv), in dem Protagonist Jimmy von seiner Kindheit in komplett autarken Konzernkomplexen erzählt. In einer durch Klimawandel zerstörten Welt haben Konzerne Enklaven gebaut, in denen ihre Arbeitnehmer sicher leben können. Dazu gehört auch, dass ihre Kinder dort zur Schule gehen. Die Konzerne bestimmen das Curriculum und legen, als Unternehmen in der pharmazeutischen Industrie oder der bio-medizinischen Entwicklung, vor allem Wert auf die Natur- und Ingenieurswissenschaften. Diese Fächer erhalten ein stärkeres Profil und werden gefördert, während Sprachen, Kunst oder Geschichte eher randständig betrachtet werden. Fächer wie Genetik oder Molekularbiologie werden dem Curriculum hinzugefügt, Labore erhalten viel Geld für Ausstattung und schon junge Schüler erschaffen in Projekten neue Produkte, die zu Firmenpatenten werden.
An den Universitäten werden diese Gedanken zur Bildung fortgeführt, in gesteigerter Form: Hier teilt der Roman die Menschen buchstäblich nach den von C. P. Snow angemahnten „two cultures“ in Lager: Naturwissenschaftler werden in luxuriös ausgestatteten Forschungseinrichtungen wie dem Watson-Crick-Institut für Genforschung zur Elite ihrer Fächer ausgebildet. Geisteswissenschaftlern werden auf der unterfinanzierten Martha-Graham-Akademie langsam ihre Ambitionen abgewöhnt und sie stattdessen für eine Karriere in PR und Marketing vorbereitet. Jimmy, der Wortmensch, der wenig Gespür für das Leben in der Zahlenwelt der Konzerne hat, wird für Atwood zum Fokus des satirischen Kommentars. Er vergleicht Literatur, Kunst, Kultur mit dem Buchbinderhandwerk: „auf seine Weise nett anzusehen, aber ohne zentrale Bedeutung“ für die reale Welt da draußen.
Dass im Roman die Naturwissenschaft in Form von Genetik-Genie Crake die Apokalypse einläutet und die Menschheit vernichtet, ist Atwoods zynischer Kommentar auf eine Welt, die ihre humanistischen Werte zugunsten von Fortschritt und Profit über Bord geworfen hat. Es ist ihre Warnung, manifest geworden in der Extrapolation der Science-Fiction, dass es auch und gerade für Naturwissenschaftler und Ingenieure, für die Lenker und Macher einer technologischen Zukunft notwendig ist, ihre Welt im Sozialen, in der Kultur, in der Geschichte und in der Philosophie zu verankern. Wir dürfen Bildung nicht rein an der Idee der employability orientieren oder sie danach bemessen, ob ihr Beitrag empirisch messbar gemacht werden kann – was zumeist in Form einer ökonomischen Auswertung erfolgt. Das Ideal einer umfänglichen und am Wachstum des Individuums in all seinen Aspekten orientierten Bildung, wie sie Wilhelm von Humboldt beschrieben hat, sollten wir uns erhalten – und das bedeutet auch, sie nicht den Interessen kapitalistischer Konzerne zu überlassen.
